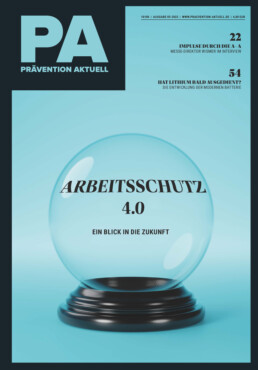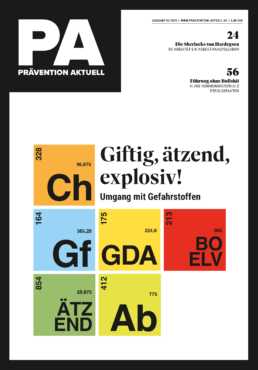- Editorial
- Schwerpunkt
- Sicher und gesund arbeiten
- Gut führen
- Nachhaltig und innovativ arbeiten
- Alles, was Recht ist
- Praxis
- Produkte & Märkte
- Damals
- Ausblick
Exoskelette: eine Chance für die Prävention

Foto: AdobeStock / Gorodenkoff
Bücken und Heben in der Logistik, Überkopfarbeiten in der Automobilindustrie – viele Tätigkeiten sind körperlich belastend. Für Abhilfe könnten Exoskelette sorgen. Gerade über die Langzeiteffekte des Nutzens dieser „Roboteranzüge“ ist noch wenig bekannt. Studien wie der Exoworkathlons® wollen die wissenschaftliche Lücke schließen.
Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!