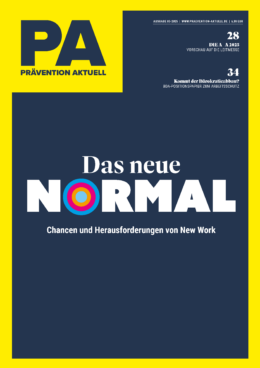- Titelthema
- Editorial
- Schwerpunkt
- Zahlen & Fakten
- Sicher und gesund arbeiten
- Gut führen
- Nachhaltig und innovativ arbeiten
- Alles, was Recht ist
- Produkte & Märkte
- Damals
- Ausblick
Radon
Wie gefährlich ist das radioaktive Gas?
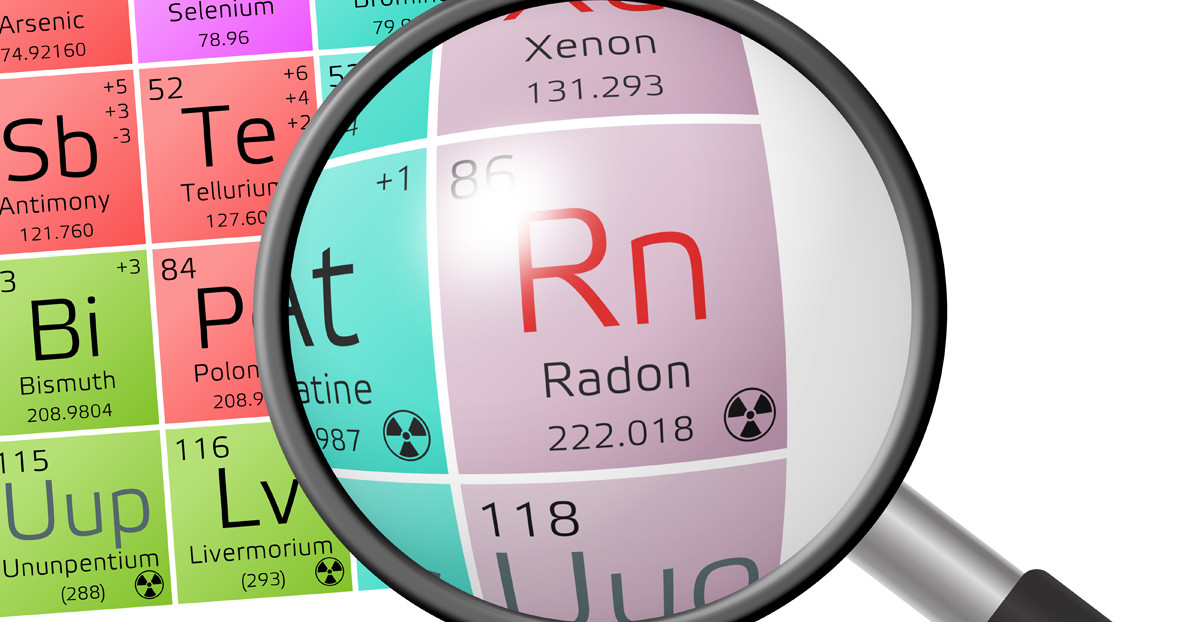
Bild: Adobe Stock / andriano_cz
Aus dem Boden ausgasendes Radon ist die größte natürliche radioaktive Gefahr und verursacht etwa fünf Prozent aller Lungenkrebsfälle in Deutschland.
Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!